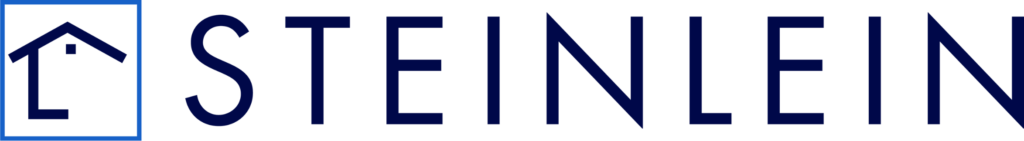Die Absetzung für Abnutzung, kurz AfA, ist eines der wichtigsten steuerlichen Instrumente für Immobilieneigentümer in Deutschland. Sie ermöglicht es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer vermieteten Immobilie über einen festgelegten Zeitraum steuerlich geltend zu machen und dadurch die jährliche Steuerlast erheblich zu reduzieren. Für Vermieter und Kapitalanleger stellt die AfA damit einen bedeutenden Faktor bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung von Immobilieninvestitionen dar.

Was ist die Abschreibung (AfA)?
Die Absetzung für Abnutzung ist eine steuerliche Vergünstigung, die den Wertverzehr von Wirtschaftsgütern berücksichtigt. Bei Immobilien geht der Gesetzgeber davon aus, dass Gebäude durch Nutzung, Witterungseinflüsse und Alterung an Wert verlieren. Diese Wertminderung kann der Eigentümer steuerlich geltend machen, indem er jährlich einen bestimmten Prozentsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten von seinen Mieteinnahmen abzieht.
Wichtig zu verstehen ist, dass nur das Gebäude selbst abgeschrieben werden kann – nicht jedoch das Grundstück. Der Grund dafür ist einfach: Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und behalten ihren Wert theoretisch unbegrenzt. Bei der Immobilienbewertung muss daher zunächst eine Aufteilung zwischen Grund und Boden sowie Gebäudewert vorgenommen werden.
Rechtliche Grundlagen der AfA
Die gesetzliche Grundlage für die Absetzung für Abnutzung findet sich im Einkommensteuergesetz (EStG). Besonders relevant sind die §§ 7 und 7h EStG, die die verschiedenen Abschreibungsmethoden und Sonderregelungen definieren. Die AfA wird im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) steuermindernd berücksichtigt.
Arten der Abschreibung bei Immobilien
Lineare Abschreibung
Die lineare AfA ist die Standardform der Abschreibung und in der Praxis am häufigsten anzutreffen. Hierbei wird jährlich ein gleichbleibender Prozentsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgeschrieben.
Für Gebäude, die ab 1925 errichtet wurden:
- Abschreibungssatz: 2% pro Jahr
- Abschreibungszeitraum: 50 Jahre
Für Altbauten, die vor 1925 errichtet wurden:
- Abschreibungssatz: 2,5% pro Jahr
- Abschreibungszeitraum: 40 Jahre
Ein Beispiel: Bei einer vermieteten Eigentumswohnung mit Bauherstellung 2020 und reinen Gebäudekosten von 300.000 Euro können jährlich 6.000 Euro (2% von 300.000 Euro) steuerlich abgesetzt werden – und das über einen Zeitraum von 50 Jahren.
Degressive Abschreibung
Die degressive AfA wurde zeitweise als Fördermaßnahme eingeführt, ist aber derzeit für Wohnimmobilien nicht mehr zulässig. Bei gewerblich genutzten Gebäuden kann sie unter bestimmten Voraussetzungen noch Anwendung finden. Das Prinzip: In den ersten Jahren wird ein höherer Prozentsatz abgeschrieben, der sich dann reduziert.
Sonder-AfA für denkmalgeschützte Immobilien
Besonders attraktiv ist die Sonder-AfA bei denkmalgeschützten Gebäuden nach § 7i EStG. Eigentümer können hier deutlich höhere Abschreibungsbeträge geltend machen:
Bei Baudenkmälern:
- In den ersten 8 Jahren: 9% der Sanierungskosten pro Jahr
- In den folgenden 4 Jahren: 7% der Sanierungskosten pro Jahr
Diese Regelung gilt sowohl für selbstgenutzte als auch für vermietete Denkmäler, wobei sich die Bedingungen leicht unterscheiden. Die Sanierungsmaßnahmen müssen mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde abgestimmt und bescheinigt werden.
AfA für Neubauten mit Förderung (§ 7b EStG)
Seit 2023 gibt es mit § 7b EStG eine zeitlich befristete Sonderabschreibung für neue Mietwohnungen. Eigentümer können hier zusätzlich zur regulären AfA eine Sonderabschreibung von bis zu 5% pro Jahr über vier Jahre geltend machen. Voraussetzungen sind unter anderem:
- Bauantrag oder Kaufvertrag zwischen 1. Januar 2023 und 31. Dezember 2027
- Einhaltung bestimmter Einkommensgrenzen bei der Vermietung
- Energetische Standards müssen erfüllt sein
Berechnung der AfA: So geht’s
Die Berechnung der Abschreibung erfolgt in mehreren Schritten:
Schritt 1: Ermittlung der Anschaffungskosten Zu den Anschaffungskosten gehören der Kaufpreis der Immobilie plus alle Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten sowie gegebenenfalls Maklergebühren.
Schritt 2: Aufteilung Grund und Boden / Gebäude Da nur das Gebäude abgeschrieben werden kann, muss eine Aufteilung vorgenommen werden. Hierfür gibt es verschiedene Methoden:
- Aufteilung laut Kaufvertrag (wenn vorhanden)
- Verhältnis der Bodenrichtwerte zum Gesamtkaufpreis
- Arbeitshilfe des Bundesfinanzministeriums
- Professionelle Immobilienbewertung durch einen Sachverständigen
Schritt 3: Bestimmung der AfA-Methode Je nach Baujahr und Nutzungsart wird die entsprechende AfA-Methode gewählt (2% oder 2,5% linear).
Schritt 4: Jährliche Abschreibung berechnen Die jährliche AfA ergibt sich aus: Gebäudeanteil × AfA-Satz
Besonderheiten und häufige Fehler
Beginn der Abschreibung
Die AfA beginnt im Monat der Anschaffung oder Fertigstellung. Wird eine Immobilie beispielsweise im Juni gekauft, können nur 7/12 der Jahres-AfA im ersten Jahr geltend gemacht werden.
Nachträgliche Herstellungskosten
Modernisierungen und Sanierungen, die über die reine Instandhaltung hinausgehen, zählen als nachträgliche Herstellungskosten. Diese erhöhen die Bemessungsgrundlage für die AfA. Eine klare Abgrenzung zwischen Erhaltungsaufwand (sofort absetzbar) und Herstellungskosten (über AfA abzuschreiben) ist wichtig.
Kaufpreisaufteilung Grund und Boden
Ein häufiger Streitpunkt mit dem Finanzamt ist die Aufteilung zwischen Grundstück und Gebäude. Während Verkäufer oft versucht sind, einen hohen Gebäudeanteil anzusetzen (günstiger für den Käufer wegen der AfA), prüft das Finanzamt diese Aufteilung kritisch. Ein unabhängiges Verkehrswertgutachten kann hier Rechtssicherheit schaffen.
Eigennutzung vs. Vermietung
Die AfA kann nur bei vermieteten Immobilien geltend gemacht werden. Selbstgenutzte Immobilien können nicht abgeschrieben werden – eine wichtige Unterscheidung bei der Investitionsentscheidung.
AfA bei verschiedenen Immobilienarten
Eigentumswohnungen
Bei Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern wird die AfA nur für die Wohnung selbst berechnet. Der Anteil am Gemeinschaftseigentum (Treppenhaus, Fassade etc.) ist bereits im Kaufpreis enthalten und wird anteilig mitabgeschrieben.
Mehrfamilienhäuser
Bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren Mieteinheiten können die gesamten Gebäudekosten nach Abzug des Grundstücksanteils abgeschrieben werden. Die Beleihungswertermittlung spielt hier oft eine wichtige Rolle bei der Finanzierung.
Gewerbeimmobilien
Gewerblich genutzte Immobilien unterliegen grundsätzlich denselben Regelungen. Bei Mischnutzung (Wohn- und Geschäftshaus) muss eine anteilige Aufteilung erfolgen.
Steuerliche Auswirkungen der AfA
Die AfA wirkt sich direkt auf die Steuerlast aus, da sie die zu versteuernden Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung reduziert. Ein Rechenbeispiel:
Ohne AfA:
- Jahresmieteinnahmen: 18.000 Euro
- Werbungskosten: 5.000 Euro
- Zu versteuernde Einkünfte: 13.000 Euro
Mit AfA:
- Jahresmieteinnahmen: 18.000 Euro
- Werbungskosten: 5.000 Euro
- AfA: 6.000 Euro
- Zu versteuernde Einkünfte: 7.000 Euro
Bei einem persönlichen Steuersatz von 35% ergibt sich durch die AfA eine Steuerersparnis von 2.100 Euro jährlich (35% von 6.000 Euro).
AfA und Immobilienbewertung
Aus Sicht der Immobilienbewertung spielt die AfA eine wichtige Rolle bei der Ertragswertberechnung. Zertifizierte Sachverständige berücksichtigen die steuerlichen Effekte der AfA bei der Ermittlung der Nettomieterträge. Besonders bei Renditeobjekten ist die korrekte Berechnung der AfA-Auswirkungen ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung.
Bei einem Kurzgutachten oder Verkehrswertgutachten wird die Aufteilung zwischen Grund und Boden sowie Gebäudewert nachvollziehbar dokumentiert, was für spätere steuerliche Nachweise wichtig ist.
Dokumentation und Nachweise
Für die Geltendmachung der AfA benötigen Eigentümer folgende Unterlagen:
- Kaufvertrag mit Kaufpreisaufteilung
- Notarkosten und Grundbuchgebühren
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Bei Sanierungen: Rechnungen und Zahlungsnachweise
- Bei Denkmalschutz: Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde
- Gegebenenfalls professionelles Wertgutachten
Aktuelle Entwicklungen und Ausblick
Die Regelungen zur AfA werden regelmäßig angepasst. Aktuell diskutiert wird:
- Verlängerung der Sonder-AfA nach § 7b EStG
- Erhöhung der AfA-Sätze zur Förderung energetischer Sanierungen
- Anpassungen bei denkmalgeschützten Immobilien
Immobilieneigentümer sollten sich daher regelmäßig über Änderungen informieren oder einen Steuerberater konsultieren.
Fazit
Die Absetzung für Abnutzung ist ein wesentliches steuerliches Instrument für Vermieter und Investoren. Durch die richtige Anwendung der AfA-Regelungen lassen sich erhebliche Steuervorteile realisieren. Besonders wichtig ist die korrekte Ermittlung der Bemessungsgrundlage und die sachgerechte Aufteilung zwischen Grund und Boden sowie Gebäudewert.
Bei Fragen zur korrekten Wertermittlung oder zur Kaufpreisaufteilung stehen zertifizierte Immobiliensachverständige mit ihrer Expertise zur Verfügung. Eine professionelle Bewertung kann nicht nur steuerliche Vorteile sichern, sondern auch spätere Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt vermeiden.
Weitere Informationen:
- Bundesministerium der Finanzen – Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung
- Einkommensteuergesetz (EStG) §§ 7, 7h, 7i, 7b